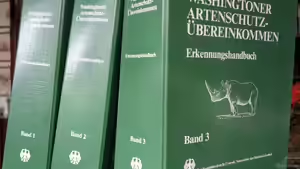Libellenlarven im Teich – Bedeutung, Lebensweise und Wechselwirkungen mit Wasserpflanzen

Libellen sind uns meist nur als schillernde Fluginsekten am Teich bewusst, doch tatsächlich spielt sich der weitaus längere Teil ihres Lebens unter Wasser ab: Als Larven leben sie über Monate oder Jahre hinweg im Verborgenen – mit maßgeblichem Einfluss auf das Teichökosystem.
Räuber im Verborgenen: Lebensweise der Larven
Die Larven der Libellen (Odonata) sind räuberisch lebende aquatische Insektenstadien, die in Abhängigkeit von Art und Umweltbedingungen ein bis drei Jahre im Wasser verbleiben, bevor sie sich zur flugfähigen Imago entwickeln. Zwei Hauptgruppen sind zu unterscheiden:

- Kleinlibellen (Zygoptera) – schlank gebaute Larven mit drei auffälligen Kiemenanhängen am Hinterleib, meist auf Pflanzenstängeln lebend.
- Großlibellen (Anisoptera) – kräftigere, gedrungene Larven mit innenliegenden Rektalkiemen, die sich meist am Boden oder zwischen Wurzeln aufhalten.
Libellenlarven jagen aktiv oder lauern versteckt auf Beute wie Kleinkrebse, Insektenlarven, Kaulquappen und gelegentlich sogar Jungfische. Ihre Fangmaske – ein ausklappbares, mit Dornen besetztes Mundwerkzeug – erlaubt blitzschnelle Beuteergreifung. Je nach Art benötigen sie für ihre Entwicklung sauerstoffreiches, möglichst strukturreiches Wasser mit passenden Mikrohabitaten.
Struktur ist entscheidend: Wechselwirkungen mit Wasserpflanzen
Die Vegetationsstruktur eines Teiches ist maßgeblich für das Vorkommen, Verhalten und die Überlebensrate von Libellenlarven. Pflanzen übernehmen dabei mehrere Funktionen:
Versteck- und Jagdstrukturen
Larven benötigen Deckung vor Fressfeinden (z. B. Fischen, Rückenschwimmern oder Wasserkäfern) und Strukturen zur Tarnung beim Beutefang.

Geeignet sind vor allem feinfiedrige Unterwasserpflanzen wie das Ährige Tausendblatt (Myriophyllum spicatum), das Raue Hornblatt (Ceratophyllum demersum) oder der Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis) sowie aufrecht wachsende Pflanzenarten wie die Wasserfeder (Hottonia palustris), das Teichlebermoos (Callitriche stagnalis) oder wasserstehende Gräser wie das Breitblättrige Rohrkolben (Typha latifolia).
Eiablageplätze für die Folgegeneration
Viele Libellenarten legen ihre Eier gezielt in Wasserpflanzen ab – entweder ins Gewebe (endophytisch, z. B. Kleinlibellen) oder an Halme (epiphytisch, z. B. Großlibellen).
Besonders bevorzugt werden Schwimmblattpflanzen wie der Gelbe Froschbiss (Nymphoides peltata), der Europäische Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae), emergente Pflanzen wie der Schilfrohrkolben (Sparganium erectum), die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und die Wasserminze (Mentha aquatica).

Ausstiegs- und Häutungsstellen
Für die Metamorphose zur Imago verlassen die Larven das Wasser und benötigen stabile, senkrechte Strukturen, an denen sie sich festhalten können.
Pflanzen mit festen Stängeln oder Halmen sind hier unverzichtbar, darunter der Breitblättrige Rohrkolben (Typha latifolia), das Fluss-Schachtelhalm (Equisetum fluviatile) oder das Großblütige Binsenrohr (Scirpus lacustris).
Ein Fehlen solcher Strukturen kann zu missglückten Häutungen führen und wirkt sich unmittelbar auf den Reproduktionserfolg aus.

Bedeutung im Ökosystem Teich
Libellenlarven spielen eine zentrale Rolle in aquatischen Nahrungsnetzen, sie regulieren die Populationen von Mückenlarven, Wasserflöhen, Eintagsfliegen und anderen Kleintieren. Gleichzeitig dienen sie selbst als Nahrung für Wasservögel (z. B. Teichhuhn, Reiher), Amphibien oder räuberische Insekten wie Gelbrandkäferlarven.
Sie sind auch Bioindikatoren: Ihr Vorkommen und ihre Artenzusammensetzung geben Hinweise auf die Wasserqualität, Strukturvielfalt und den Fischbesatz. Viele Arten meiden stark eutrophierte oder fischreiche Teiche.
Optimale Bedingungen schaffen
Wer Libellenlarven gezielt fördern möchte, sollte folgende Bedingungen im Teich schaffen:
- Verzicht auf Fischbesatz oder nur geringe Fischdichte mit standorttreuen Arten (z. B. Moderlieschen).
- Unterschiedliche Tiefenzonen, mit flachen Uferbereichen für emergente Pflanzen.
- Vielfältige Vegetation, insbesondere heimische Arten mit differenzierter Struktur.
- Belassen von abgestorbenen Pflanzenstängeln bis ins Frühjahr, um Ausstiegsmöglichkeiten zu erhalten.
- Keine übermäßige Entfernung von Aufwuchs und Tauchpflanzen.
Autorin: Caroline Haller für www.einrichtungsbeispiele.de